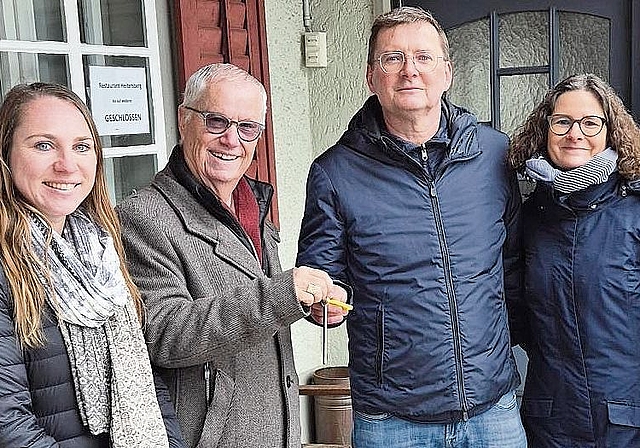Primi Piatti für das Heim(at)gefühl
Sie sind zum Arbeiten oder auf der Flucht in die Schweiz gekommen: Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund. Die zunehmende Diversität stellt Pflegeeinrichtungen vor Herausforderungen.
Es ist nachmittags um zwei und im dritten Stock des Pflegeheims Senevita Lindenbaum in Spreitenbach ist die Stimmung erstaunlich heiter. Die dementen Männer und Frauen, die hier in einer geschützten Abteilung wohnen, essen Dolci und trinken Caffè. Aus einem CD-Player trällern italienische Hits aus den 80ern; Toto Cutugno, Al Bano, Eros Ramazzotti. Die Männer und Frauen kennen die Lieder von früher, sie singen und klatschen mit, so laut, dass man sie wohl von draussen hört. Und ehe man sich’s versieht, «täppeln» sie in einer Polonaise zwischen den Tischen hindurch. Was ist hier los? Hat jemand Geburtstag?
«Nein», sagt Tanja Cugovcan, die im Senevita Lindenbaum den Pflegedienst leitet, «so läuft es hier meistens.» Sie steht in der Türe zum Gemeinschaftsraum und blickt lächelnd in die Runde der Bewohnenden, von denen sich einige wieder gesetzt haben. Eine Frau hält eine miauende Katzenpuppe, ein Mann klimpert auf dem Xylophon. Jeden Nachmittag finden sie hier zusammen für die sogenannte Aktivierung. Sie spielen, stricken, zeichnen und singen zusammen, manchmal machen sie Spaziergänge.
In einem der Ohrensessel an der Wand sitzt Italia di Gaetano. Sie wirkt vergnügt, immerzu lacht sie und findet alles «bellissimo!». Bis vor fünf Jahren lebte sie in Italien, erzählt Monica di Gaetano, Italias Tochter. Sie sitzt neben ihrer Mutter und übersetzt die Gesprächsbrocken, die auf Italienisch aus Italia heraussprudeln.
Primi Piatti fürs Heimatgefühl
Als Italias Mann starb und sie an Demenz erkrankte, holten die Kinder sie in die Schweiz. Da Italia kein Deutsch spricht, haben sie, die Kinder, nach einer Institution gesucht, wo ihre Mutter gut aufgehoben wäre, sagt Monica di Gaetano. In Spreitenbach sind sie fündig geworden. Die Männer und Frauen, die mit Italia di Gaetano hier wohnen, haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind dement und stammen aus dem Mittelmeerraum, die meisten aus Italien. Hier, in diesem ovalen Bau direkt neben dem Shoppi Tivoli, hat das Pflegeheim Senevita Lindenbaum eine Demenzabteilung speziell für sie eingerichtet. Sie nennen das den mediterranen Wohnbereich. Die Pflegefachkräfte, die hier arbeiten, müssen alle mindestens Italienisch und Deutsch sprechen, sagt die Pflegedienstleiterin Tanja Cugovcan, vorzugsweise auch Portugiesisch. Insgesamt arbeiten im Senevita Lindenbaum Pflegerinnen und Pfleger mit 34 Nationalitäten.
Die Bewohnenden in ihrer Muttersprache zu betreuen, helfe, eine Bindung zu ihnen aufzubauen, sagt Cugovcan. «Bei Menschen mit Demenz ist das besonders wichtig.» Sie sollen sich hier zu Hause fühlen. Darum serviert ihnen die Küche auf Wunsch etwa auch einen Teller Pasta als Primo. Und das Pflegeheim organisiert immer mal wieder ein italienisches Konzert.
Essen, Sprache und Rituale zentral für die Geborgenheit
Mediterrane Abteilungen gibt es auch in anderen Pflegeheimen, zum Beispiel in Bern, Basel und Zürich. Sie sind in den vergangenen Jahren auf Initiative von migrantischen Organisationen entstanden. Meist wohnen dort ehemalige Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter aus Italien, Spanien und Portugal.
«Das sind Menschen, die hier alt geworden sind, obwohl sie ursprünglich nicht beabsichtigt haben, zu bleiben», sagt Sozialanthropologin Eva Soom Ammann, die an der Berner Fachhochschule zu Migration und Alter lehrt und forscht. Dasselbe gelte häufig für Migrantinnen und Migranten aus anderen Ländern. Oftmals verbringen sie ihr Leben in der Schweiz und bleiben wegen ihrer Kinder, Enkel und Freunde, sagt Soom Ammann. «Ihre Beziehungen sind hier, ihre Wohnung, ihr Schrebergarten.» Und: Sie wollen ihren hart erkämpften, kleinen Wohlstand und die gute Gesundheitsversorgung bewahren. Oder: Sie können nicht zurück, weil sich dort, wo sie herkommen, über die Jahrzehnte zu vieles verändert hat.
Sprache ist zentral
Bei Migrantinnen und Migranten, die in der Schweiz lange nicht ganz zugehörig waren, sei die Verunsicherung beim Eintritt ins Pflegeheim grösser als bei den Einheimischen, sagt Soom Ammann. Da sei die Sprache zentral. «Sie wollen sich mit anderen austauschen können und sicher sein, gehört und verstanden zu werden.» Aber auch die Rücksicht auf Essensgewohnheiten und religiöse Rituale sei für das Wohlbefinden entscheidend. «Vertrauen und Geborgenheit sind menschliche Bedürfnisse», sagt Soom Ammann. «Gerade in Altersheimen, wo die Bewohnerinnen und Bewohner – nicht nur jene mit Migrationsgeschichte – stark abhängig sind.»
Individuelle Pflege im Heim: Für die Institutionen bedeutet das Zusatzaufwand. Umso mehr, als die Bevölkerung immer diverser wird. Wie steht es zum Beispiel um Menschen aus Sri Lanka, der Türkei, dem Kosovo oder Nordmazedonien? Serbien oder Kroatien? Marokko, Eritrea? Kriegen auch sie irgendwann ihre eigenen Abteilungen?
Flexible Altersheime
und andere Modelle
Die Sozialanthropologin Damaris Lüthi hat 2018 ältere Tamilinnen und Tamilen zu ihrer Situation im Alter befragt. Sie gaben an, dasssie sich vorstellen könnten, in ein ethnisch gemischtes Pflegeheim einzutreten, sobald sie stationär pflegebedürftig sind. «Es gibt aber Hemmungen», sagt Lüthi. «Da traditionell die Familie für alte Angehörige sorgt, haben viele der Befragten Angst vor einem Rufschaden der Familie.» Gleichzeitig wissen die Befragten, dass dieses frühere Modell nicht praktikabel ist. Den Kindern, für deren Ausbildung die Eltern sich eingesetzt haben, fehlt die Zeit für diese Betreuung.
Von einem Altersheim wünschen sich die Interviewten ein ethno-spezifisches Angebot ähnlich demjenigen für die Italienerinnen und Italiener, sagt Lüthi: tamilisches Essen und tamilischsprachiges Personal sowie Rücksicht auf ihre Gewohnheiten und die Möglichkeit, ihre Religionen zu praktizieren.
Immer mehr Abteilungen, um allen gerecht zu werden – das hält Eva Soom Ammann für unrealistisch. «Wir brauchen Altersheime, die genügend Ressourcen haben, um flexibel mit Diversität umgehen zu können», sagt sie. Oder andere Modelle: kleinere Wohngruppen, Alters-WGs, intergenerationelles Wohnen.
In der tamilischen Gemeinschaft gibt es bereits Eigeninitiativen, zum Beispiel in Bern: Dort plant die Genossenschaft Tamil Kudil ein Mehrgenerationenhaus. Zwei Drittel der Wohnungen sollen an Tamilinnen und Tamilen über sechzig vergeben werden, der Rest an jüngere Menschen und Familien.
Ein weiteres Beispiel sind die sechs jüdischen Pflege- und Altersheime in der Schweiz. Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds, sagt: «Viele ältere Menschen wollen auch im Alter ein Leben nach jüdischer Tradition führen, gerade wenn sie weniger mobil sind.» Koscher essen, Schabbat feiern – das können sie in den jüdischen Altersinstitutionen. Die meisten haben einen Betsaal integriert.
Das Wichtigste ist der Inklusionsgedanke
Zurück im Senevita Lindenbaum in Spreitenbach. Pflegedienstleiterin Tanja Cugovcan steht im Zimmer einer Bewohnerin der mediterranen Demenzabteilung. Die Bewohnerin hat hier Bilder aufgehängt, schwarz-weisse Porträts von früher, daneben Farbfotos der Enkel. Auf der Kommode stehen Orchideen auf gehäkelten Deckchen.
An den Anmeldungen fürs Pflegeheim lasse sich kein Bedürfnis erkennen, dass es mehr gruppenspezifische Abteilungen brauche, sagt Cugovcan. So oder so: Die Pflege im Senevita Lindenbaum richte sich schon heute nach den individuellen Bedürfnissen der Bewohnenden. «Wir respektieren und berücksichtigen zum Beispiel alle Religionen», sagt Cugovcan. Bei muslimischen Bewohnern könne das etwa die Totenwäsche sein. Als eine russische Bewohnerin verstarb, wurde ein orthodoxer Priester organisiert. Die integrative Pflege und Betreuung folgt einem Inklusionsgedanken, sagt Cugovcan. «Das ist für uns das Wichtigste.»